Warum dieses Thema aktueller ist denn je
Lithium-Ionen-Akkus sind aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken: Sie stecken in Werkzeugen, Smartphones, Laptops, E-Bikes, Flurfahrzeugen und zunehmend auch in Einwegprodukten wie E-Zigaretten oder sogenannten „Vapes“. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: hohe Energiedichte, kompaktes Design, schnelle Ladezyklen. Doch mit der Verbreitung wachsen auch die Risiken – insbesondere für Arbeitssicherheit, Brandschutz und Unternehmensschutz.
Die VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft) sowie andere Berufsgenossenschaften warnen bereits seit Jahren vor unsachgemäßer Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus. Dieser Beitrag gibt einen praxisorientierten Überblick über Gefahren, Schutzmaßnahmen und konkrete Empfehlungen für den betrieblichen Alltag.
Hinweis: Die hier dargestellten Informationen dienen der allgemeinen Sensibilisierung und ersetzen keine individuelle Gefährdungsbeurteilung oder rechtlich bindende Beratung. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder Aktualität.
1. Die konkreten Gefahren von Lithium-Ionen-Akkus
Lithium-Ionen-Akkus sind leistungsfähig, kompakt und vielseitig – aber bei falscher Handhabung potenziell brandgefährlich. Die physikalischen und chemischen Prozesse im Inneren der Akkus reagieren empfindlich auf äußere Einflüsse wie Hitze, mechanische Beschädigung oder Überladung. Eine mangelhafte Lagerung, unkontrolliertes Aufladen oder falsche Entsorgung kann schwerwiegende Folgen haben. Im betrieblichen Umfeld multiplizieren sich diese Risiken durch größere Mengen und häufige Nutzung.
Thermisches Durchgehen ("Thermal Runaway")
Ein Defekt im Akku kann eine Kettenreaktion auslösen: Der Akku überhitzt, entzündet sich selbst und ist kaum mehr zu löschen. Besonders gefährlich, wenn dies unbemerkt geschieht (z. B. nachts oder in Abstellräumen).
Zur Erklärung: Beim thermischen Durchgehen handelt es sich um eine unkontrollierte Kettenreaktion im Inneren des Akkus. Diese wird häufig ausgelöst durch mechanische Beschädigungen, interne Kurzschlüsse oder starke Hitzeeinwirkung. Einmal gestartet, heizt sich die Zelle durch chemische Reaktionen selbst weiter auf – teilweise bis über 600 °C. Die Folge: Der Akku bläht sich auf, setzt brennbare Gase frei und entzündet sich explosionsartig. Diese Art von Reaktion ist nicht mit konventionellen Löschmethoden zu stoppen und stellt eine erhebliche Gefahr für Mensch und Material dar.
Brandgefahr durch unsachgemäße Ladung
- Aufladen mit Billigladegeräten
- Nutzung von Akkus mit sichtbaren Schäden
- Dauerladung über Nacht ohne Aufsicht
Fehler beim Laden gehören zu den häufigsten Ursachen für Akkubrände in Betrieben. Viele Mitarbeitende nutzen günstige, nicht zertifizierte Ladegeräte, laden Akkus über Nacht oder in unkontrollierten Umgebungen (z. B. Transportfahrzeuge, Werkbänke). Auch beschädigte oder alte Akkus werden häufig weiterhin geladen, obwohl sie ein hohes Ausfallrisiko bergen. Kritisch wird es insbesondere dann, wenn mehrere Ladeeinheiten gleichzeitig in nicht gesicherten Bereichen betrieben werden.
Unsachgemäße Lagerung
- Lagerung in direkter Sonneneinstrahlung oder bei Überhitzung
- Kontakt mit Wasser, Staub oder Metallteilen
- Unzureichend geschützte Lagerräume
Die falsche Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus – etwa auf Fensterbänken mit direkter Sonneneinstrahlung oder in geschlossenen Räumen mit hohen Temperaturen – kann zum unbemerkten Wärmestau führen. Auch der Kontakt mit leitfähigen oder feuchten Materialien (z. B. Metall, Flüssigkeiten, Staub) erhöht das Risiko eines Kurzschlusses. Besonders gefährlich: das gemeinsame Lagern intakter und defekter Akkus ohne räumliche Trennung oder Kennzeichnung.
Entsorgungsproblematik
Immer mehr Akkus landen im Rest- oder Verpackungsmüll, darunter auch E-Zigaretten, Bluetooth-Boxen oder Einweg-Vapes. Diese unsachgemäße Entsorgung führt bei Entsorgungsunternehmen regelmäßig zu Bränden in Fahrzeugen oder Recyclinganlagen.
Mit der wachsenden Anzahl an Kleingeräten steigen auch die Entsorgungsprobleme. Viele Akkus landen achtlos im Gelben Sack, im Restmüll oder im Elektroschrottcontainer – oft in verbauten Geräten wie Einweg-Vapes, Powerbanks, E-Zigaretten oder Spielzeugen. Das führt immer wieder zu Bränden in Müllfahrzeugen oder Sortieranlagen. Laut der Stiftung GRS Batterien wurden allein im Jahr 2022 mehr als 150 Zwischenfälle durch Akkus in Entsorgungsbetrieben gemeldet. Die Brandlast ist hoch – nicht nur für die Anlagen, sondern auch für Mitarbeitende.
Besonder kritisch:
Unkenntlich verbaute Akkus in Wegwerfprodukten, die vom Verbraucher nicht als gefährlich wahrgenommen werden. Dadurch fehlt häufig auch die Sensibilität bei der Trennung und korrekten Entsorgung.
2. Praxisbeispiele aus Unternehmen
Die Gefahren von Lithium-Ionen-Akkus sind längst keine theoretischen Szenarien mehr. Unternehmen verschiedenster Branchen sehen sich mit realen Vorfällen konfrontiert, die sowohl Mitarbeiter als auch Infrastruktur gefährden. Aktuelle Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit:
Über 1.000
Brände jährlich in Entsorgungsbetrieben
werden laut Entsorger-Verbänden durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus verursacht – vor allem durch Geräte wie E-Zigaretten, Powerbanks oder Elektrowerkzeuge.
Quelle: BDE, IFAT 2023
Nur ca. 30%
der Betriebe verfügen über ein dokumentiertes Notfallkonzept
für Akkubrände – so der geschätzte Wert auf Basis interner Auswertungen von Schulungsträgern und Sicherheitsexperten.
Quelle: Fachportale & Schulungsanbieter (z. B. Sifa-Sibe.de)
Rund 60%
der Mitarbeitenden wissen nicht, wie sie sich im Akkubrandfall verhalten sollen
Diese Zahl basiert auf Einschätzungen von Fachkräften für Arbeitssicherheit und unternehmensinternen E-Learning-Analysen.
Quelle: Schulungserfahrungen, Branchenreports
Jeder 10.
Gewerbebrand geht laut Branchenberichten auf Lithium-Ionen-Akkus zurück. Experten schätzen den Anteil akkubedingter Brände in Industrie und Handwerk inzwischen auf 10–15 %.
Quelle: Fachmagazin Sifa-Sibe, 2023
Typische Praxisbeispiele:
Entsorgungsbetriebe
berichten von täglichen Zwischenfällen durch Akkus in Gelben Säcken. Neben den Brandgefahren erhöhen sich auch die Versicherungskosten und Ausfallzeiten.
Bauunternehmen
erleben Akkubrände durch defekte Werkzeugakkus, die in Servicefahrzeugen oder Containern ohne Überwachung geladen werden – teils mit Totalschäden.
Büro- und Technikunternehmen
lagern E-Bike- oder Laptop-Akkus in Fluren, unter Tischen oder im Technikraum – häufig ohne Brandschutzkonzept oder getrennte Lagerung.
Eindeutige Tendenz:
Die Anzahl der meldepflichtigen Akkubrände hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Durch die zunehmende Elektrifizierung – nicht nur im privaten Bereich, sondern auch durch akkubetriebene Werkzeuge, Geräte und Fahrzeuge in Unternehmen – steigt die Zahl potenzieller Zündquellen kontinuierlich an. Besonders kritisch ist die Kombination aus fehlendem Gefahrenbewusstsein, wachsender Zahl an Geräten und unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen.
Viele Betriebe unterschätzen das Risiko nach wie vor, obwohl bereits kleine Fehler in der Lagerung oder Nutzung schwerwiegende Folgen haben können. Jedes Unternehmen, unabhängig von Größe oder Branche, welches mit dem Thema konfrontiert ist sollte Handeln – proaktiv und strukturiert.
3. Schutzmaßnahmen im Betrieb
Der Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus erfordert klare betriebliche Strukturen und Verantwortlichkeiten. Schutzmaßnahmen dürfen dabei nicht nur als Reaktion auf Vorfälle verstanden werden – vielmehr sind sie Bestandteil einer vorausschauenden Sicherheitsstrategie. Unternehmen sollten das Thema daher systematisch angehen und organisatorisch, technisch sowie personell verankern.
Um den Gefahren von Lithium-Ionen-Akkus wirkungsvoll zu begegnen, sind gezielte Schutzmaßnahmen erforderlich. Diese lassen sich in vier Hauptbereiche gliedern:

1. Sichere Lagerung
- Akkus sollten in nicht brennbaren, belüfteten Schränken oder speziellen Ladeschränken aufbewahrt werden.
- Eine räumliche Trennung von anderen brennbaren Materialien ist Pflicht.
- Defekte oder beschädigte Akkus müssen unverzüglich ausgesondert und in speziellen Sammelbehältern gesichert werden.
2. Ordnungsgemäßes Laden
- Ladevorgänge niemals unbeaufsichtigt durchführen.
- Ladebereiche müssen feuertechnisch gesichert sein (z. B. Rauchmelder, feuerfeste Unterlage, Brandschutzmatten).
- Original-Ladegeräte verwenden und Überlastung der Stromkreise vermeiden.
3. Technische & organisatorische Maßnahmen
- Einführung von Betriebsanweisungen für den sicheren Umgang mit Akkus.
- Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung gemäß §5 ArbSchG unter Einbindung von Sicherheitsfachkräften.
- Kennzeichnungspflicht für Akkus mit hohem Energiegehalt.
4. Regelmäßige Prüfung & Wartung
- Prüfung von Akkus, Ladegeräten und Lagereinrichtungen nach DGUV Vorschrift 3.
- Feste Wartungsintervalle für Geräte mit eingebauten Akkus definieren.
- Einsatz von Brandschutzsensorik in Bereichen mit hohem Akkuvorkommen.
Diese Maßnahmen sollten in bestehende Managementsysteme (z. B. nach ISO 9001 oder ISO 27001) integriert werden. Ein zentraler Bestandteil ist dabei auch die Dokumentation von Maßnahmen, Zuständigkeiten und Schulungen. So wird das Thema „Akkusicherheit“ nicht nur zur Compliance-Frage, sondern zur aktiven Prävention.
4. So sollte man sich im Brandfall verhalten
Ein brennender Lithium-Ionen-Akku stellt eine besondere Gefahr dar, da er nicht wie ein herkömmlicher Brand behandelt werden kann. Unternehmen müssen ihre Mitarbeitenden auf den Ernstfall vorbereiten und klar regeln, wie im Fall einer Rauchentwicklung oder eines Brandes zu handeln ist.
Warnzeichen und Brandverlauf
Weiße Rauchentwicklung
kann ein Hinweis auf einen beginnenden thermischen Durchgehvorgang („Thermal Runaway“) sein – bereits in diesem Stadium ist höchste Vorsicht geboten.
Schwarzer, dichter Rauch
deutet auf ein vollständiges Akkubrandgeschehen hin – dieser Rauch enthält toxische Gase wie Fluorwasserstoff (HF) und andere Reizstoffe.

Achtung: Das Einatmen der entstehenden Dämpfe ist hochgefährlich und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tode führen. Betroffene Bereiche müssen sofort geräumt werden.
Notfallmaßnahmen
- Brand melden und Feuerwehr alarmieren – auch bei vermeintlich kleinem Schaden.
- Nur geschultes Personal darf Löschversuche unternehmen – idealerweise mit Speziallöschmitteln wie Metallbrandlöschern (Klasse D) oder speziellen Akkulöschcontainern.
- Evakuierungsmaßnahmen einleiten, Zugang zum Gefahrenbereich sperren.
Nach dem Brand:
- Akku-Reste sichern und separat entsorgen (nicht im normalen Müll!)
- Mitarbeitende medizinisch überprüfen lassen, insbesondere bei Kontakt mit Rauch oder Rückständen.
- Brandereignis dokumentieren und Gefährdungsbeurteilung aktualisieren.
Unsere Empfehlung:
Ein durchdachtes Notfallkonzept, regelmäßige Übungen und die Einbindung von Brandschutzbeauftragten sind entscheidend, um im Ernstfall richtig zu handeln – und Leben zu schützen.
5. Mitarbeiter sensibilisieren: So klappt es!
Technische Maßnahmen und Brandschutzvorkehrungen können nur dann wirksam greifen, wenn alle Beschäftigten über die Risiken und den richtigen Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus informiert und geschult sind. Die Sensibilisierung der Mitarbeitenden ist daher ein zentraler Baustein der betrieblichen Sicherheitsstrategie.
Schulungsinhalte definieren
Die Schulungen sollten folgende Themen enthalten:
-
Grundlagen zu Aufbau und Funktionsweise von Lithium-Ionen-Akkus
-
Typische Gefahrenquellen und Schadensbilder
-
Richtiges Verhalten bei Rauchentwicklung oder Brand
-
Umgang mit defekten oder beschädigten Akkus
-
Sichere Lade- und Lagerpraktiken im Betrieb
Schulungsformate variieren
Zur nachhaltigen Vermittlung des Wissens empfehlen sich verschiedene Methoden:
- Präsenzschulungen mit praktischen Übungen (z. B. Verhalten im Brandfall)
- E-Learning-Module für flexibles Lernen
- Aushänge und visuelle Hinweise an Lade- und Lagerplätzen
- Sicherheitsunterweisungen im Rahmen von Teammeetings
Führungskräfte einbinden
Besonders wichtig: Auch Führungskräfte und Vorgesetzte müssen geschult werden, damit sie als Multiplikatoren agieren und die Einhaltung der Schutzmaßnahmen kontrollieren können. Sie tragen eine besondere Verantwortung für die Umsetzung im Arbeitsalltag.
Kommunikation regelmäßig erneuern
Die Gefahr durch Akkus verändert sich mit der technischen Entwicklung. Deshalb sollte auch die Kommunikation zu diesem Thema kontinuierlich angepasst werden:
-
Regelmäßige Auffrischungsschulungen (mind. einmal jährlich)
-
Berücksichtigung neuer technischer Geräte oder Arbeitsmittel mit Akkus
-
Einbindung in bestehende Schulungspläne z. B. zur Arbeitssicherheit oder Brandschutz
Ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Wissen im Kollegenkreis senkt nicht nur das Risiko für Unfälle, sondern stärkt auch die allgemeine Sicherheitskultur im Unternehmen. Sensibilisierte Mitarbeitende handeln vorausschauender – und können im Ernstfall Leben retten.
6. Aktuelle Empfehlungen der Berufsgenossenschaften (u. a. VBG, DGUV)
Die Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger haben in den letzten Jahren zahlreiche Handlungsempfehlungen, Merkblätter und Schulungsmaterialien veröffentlicht, die Unternehmen beim sicheren Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus unterstützen sollen. Besonders hervorzuheben sind:
VBG – Handlungshilfe: Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus
- Enthält praxisnahe Maßnahmen zur sicheren Lagerung, Verwendung und Entsorgung.
- Gibt konkrete Hinweise zur Gefährdungsbeurteilung und Integration in den Arbeitsschutz.
Quelle: Vbg.de
DGUV – Merkblatt „Lithium-Akkus sicher verwenden“
- Übersicht zu technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen.
- Hinweise zur Lagerung, dem Verhalten im Notfall und zur Schulung von Mitarbeitenden.
Quelle: DGUV Information 205-041 – Brandschutz beim Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien
BG ETEM – Brancheninformationen zur Akkusicherheit
-
Besonderer Fokus auf elektrotechnische Betriebe und Werkstätten.
-
Beinhaltet Checklisten, Prüfintervalle und Gefährdungsbeispiele.
Feuerwehr und Katastrophenschutz
-
Warnen vor falscher Entsorgung von Akkus, insbesondere aus Haushaltsgeräten oder E-Zigaretten.
-
Unterstützen Betriebe bei der Erstellung von Notfallplänen und Schulungskonzepten.
Die Empfehlungen sind regelmäßig zu prüfen und – wo möglich – in betriebliche Abläufe zu integrieren. Unternehmen, die ihre Gefährdungsbeurteilung, Brandschutzmaßnahmen und Schulungskonzepte auf Basis dieser Quellen gestalten, sind rechtlich besser abgesichert und schützen gleichzeitig Mitarbeitende und Sachwerte.
7. Fazit: Akkusicherheit ist Unternehmenssicherheit
Lithium-Ionen-Akkus sind leistungsfähige Energieträger – aber sie bringen auch ernstzunehmende Risiken mit sich. Unternehmen, die sich diesen Gefahren frühzeitig bewusst sind, können mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen viel bewirken: von sicherer Lagerung über klare Verhaltensregeln bis hin zur gezielten Schulung der Mitarbeitenden.
Die Verantwortung liegt nicht allein beim Arbeitsschutz oder der Technikabteilung. Vielmehr ist Akkusicherheit ein unternehmensweites Thema, das Führungskräfte, Sicherheitsbeauftragte und Mitarbeitende gleichermaßen betrifft. Die vorgestellten Empfehlungen, Praxisbeispiele und Handlungshilfen bieten einen konkreten Rahmen, um Risiken zu erkennen, zu reduzieren und die betriebliche Sicherheit nachhaltig zu erhöhen.
Wer präventiv handelt, senkt nicht nur das Unfall- und Brandrisiko, sondern erfüllt auch seine gesetzliche Fürsorgepflicht – und schützt dabei Menschen, Sachwerte und die Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens.
Bleiben Sie wachsam. Bleiben Sie vorbereitet. Und investieren Sie in Sicherheit – es lohnt sich.
Jetzt handeln: Schulung, Beratung oder Umsetzung?
Sie möchten Lithium-Ionen-Akkus sicher in Ihrem Unternehmen einsetzen, Schulungskonzepte entwickeln oder bestehende Prozesse optimieren? Wir unterstützen Sie praxisnah bei:
-
der Erstellung individueller Sicherheitskonzepte,
-
der Schulung Ihrer Mitarbeitenden,
-
der Integration in bestehende Managementsysteme (z. B. ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001)
-
oder bei der Gefährdungsbeurteilung nach DGUV und ArbSchG.
Kontaktieren Sie uns jetzt für ein unverbindliches Erstgespräch! Gemeinsam erhöhen wir die Sicherheit in Ihrem Betrieb – effektiv, rechtssicher und praxisorientiert.
Weitere Beiträge, die Sie interessieren könnten:

Pläne zur DSGVO-Reform 2025: Entlastung für KMU in Sicht?
DSGVO-Reform 2025 – echte Entlastung für KMU oder nur ein politisches Signal? Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit 2018 das...
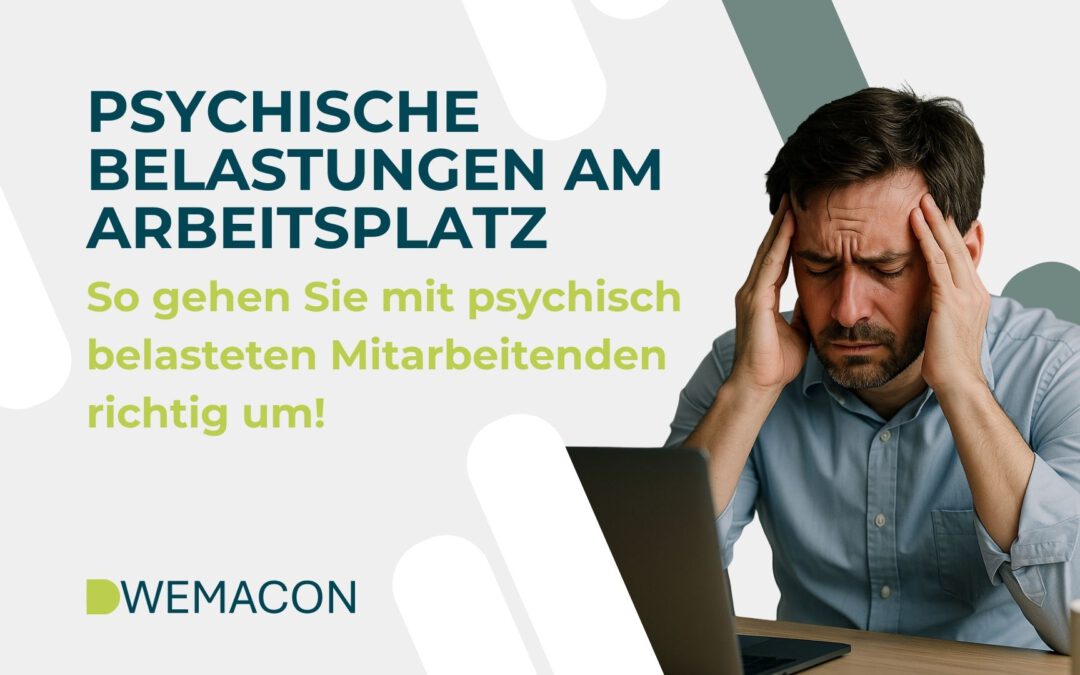
Psychische Belastung am Arbeitsplatz – Prävention, Schutz und Lösungswege im Rahmen des Arbeitsschutzes
Psychische Belastung - ein oft unterschätzes Thema Psychische Belastungen am Arbeitsplatz sind längst kein Randthema mehr. Stress,...
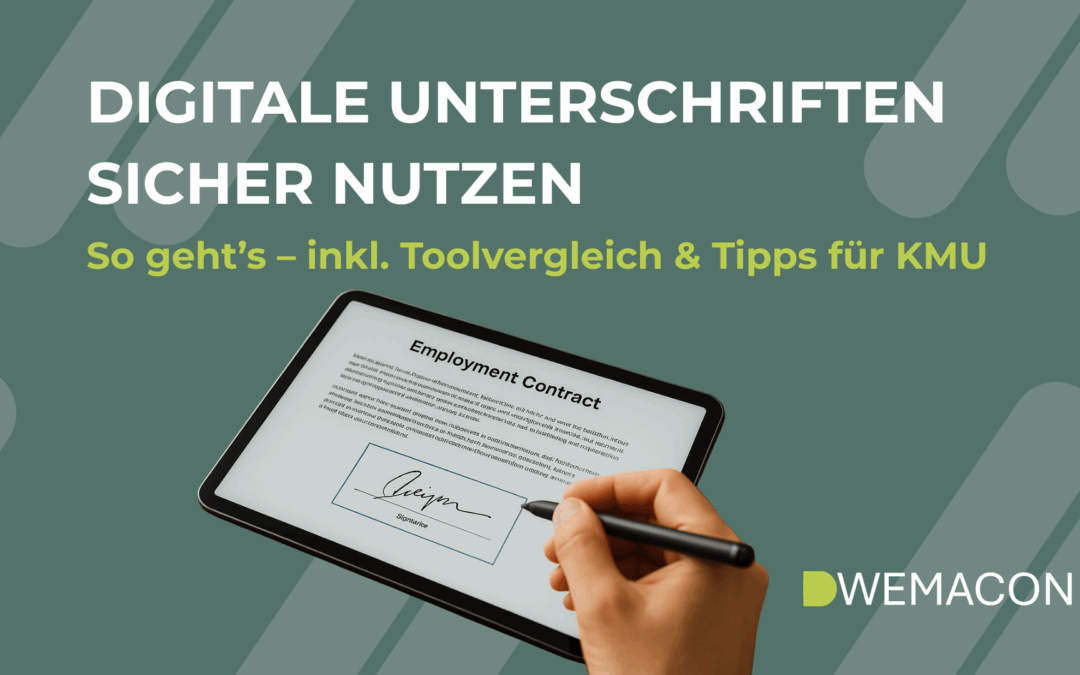
Digitaler Wandel bei Arbeitsverträgen: Digitale Unterschriften rechtssicher nutzen – so geht’s
Warum digitale Signaturen jetzt wichtiger sind denn je Hybrides Arbeiten, mobiles Onboarding, digitale Unterweisungen – Unternehmen stehen...
