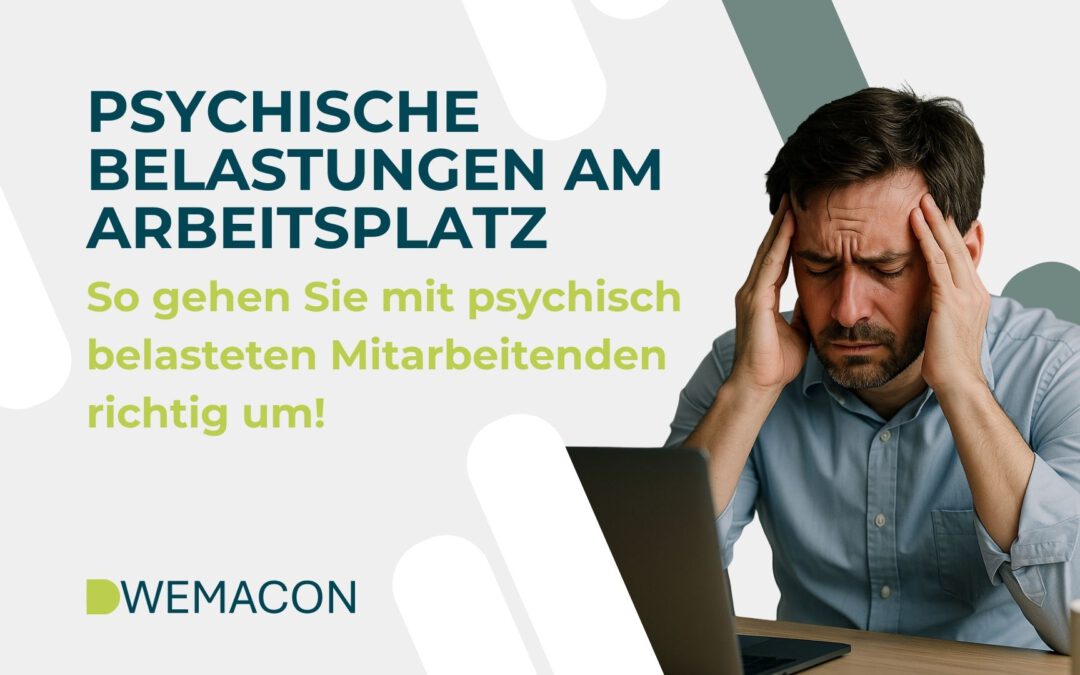Psychische Belastung – ein oft unterschätzes Thema
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz sind längst kein Randthema mehr. Stress, Dauererreichbarkeit, Konflikte im Team, steigender Leistungsdruck und mangelnde Erholung führen in vielen Unternehmen zu einer schleichenden Überlastung von Mitarbeitenden – mit teils gravierenden Folgen: sinkende Leistungsfähigkeit, vermehrte Fehlzeiten, Burnout.
Der Arbeitsschutz verpflichtet Arbeitgeber, nicht nur physische, sondern auch psychische Gefährdungen systematisch zu erkennen und zu reduzieren (§5 ArbSchG).
Doch wie gelingt das in der Praxis? Und wie können Unternehmen proaktiv handeln, statt nur auf Krisen zu reagieren?
Hinweis: Dieser Beitrag berücksichtigt den Stand der gesetzlichen Regelungen und Empfehlungen zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gemäß Arbeitsschutzgesetz (§ 5 ArbSchG) und der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) mit Stand 08/2025. Rechtliche Vorgaben können sich ändern – bitte prüfen Sie bei der Umsetzung stets den aktuellen Stand der Gesetzgebung und ggf. branchenspezifische Vorschriften.
Inhaltsverzeichnis
1. Psychische Belastung – Begriffsdefitionen im Arbeitsschutz
3. Auswirkungen – Warum Unternehmen handeln müssen
5. Prävention & Ursachenbehandlung – der ganzheitliche Ansatz
6. Umgang mit bereits belasteten Mitarbeitern – inkl. Checkliste zum Downloaden
1. Psychische Belastung – Begriffsdefitinion im Arbeitsschutz
Nach der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) beschreibt der Begriff psychische Belastung alle Einflüsse, die von außen auf eine Person einwirken und deren Psyche beanspruchen.
Dabei ist wichtig:
Psychische Belastung an sich ist zunächst neutral – sie kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Erst wenn die Belastung zu hoch, zu lange andauernd oder nicht ausreichend ausgleichbar ist, kann sie zu psychischer Fehlbeanspruchung werden, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.
Die GDA unterscheidet dabei verschiedene Handlungsfelder, in denen solche Belastungen auftreten können:
1.1 Arbeitsinhalt & Arbeitsaufgabe
Der Inhalt und die Art der Arbeit bestimmen maßgeblich, wie herausfordernd oder belastend eine Tätigkeit empfunden wird.
Mögliche Belastungsfaktoren sind:
Monotone Tätigkeiten,
die wenig geistige Anregung bieten und zu Unterforderung führen (z. B. repetitive Dateneingabe).
Überforderung
durch zu komplexe oder mengenmäßig nicht bewältigbare Aufgaben.
Widersprüchliche Anforderungen,
bei denen Zielkonflikte entstehen.
Fehlende Gestaltungsspielräume
und mangelnde Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen.
1.2 Arbeitsorganisation
Die Rahmenbedingungen der Arbeitsabläufe wirken direkt auf das psychische Erleben. Belastend können sein:
Schichtarbeit
oder wechselnde Arbeitszeiten, die den Biorhythmus stören.
Unklare Verantwortlichkeiten,
bei denen nicht klar ist, wer welche Aufgabe übernimmt.
Ständige Unterbrechungen
durch Telefonate, Mails oder Ad-hoc-Anfragen, die konzentriertes Arbeiten erschweren.
Fehlende Planbarkeit,
z. B. durch kurzfristige Änderungen von Aufgaben oder Projekten.
1.3 Soziale Beziehungen am Arbeitsplatz
Das Miteinander im Team, die Führungsqualität und die soziale Unterstützung sind entscheidende Faktoren für psychische Gesundheit. Risikofaktoren sind:
Konflikte
zwischen Kolleg:innen oder mit Vorgesetzten.
Mobbing,
Ausgrenzung oder Diskriminierung.
Fehlende Wertschätzung
und Anerkennung von Leistungen.
Mangelnde Unterstützung
bei Arbeitsproblemen oder in Krisensituationen.
1.4 Arbeitsumgebung
Die physische Umgebung wirkt oft indirekt, kann aber erheblich zur psychischen Belastung beitragen:
Lärm,
der Konzentration und Kommunikation erschwert.
Ungünstige ergonomische Bedingungen,
die körperlich ermüden und indirekt mental belasten.
Fehlende Rückzugsmöglichkeiten
für konzentriertes Arbeiten oder Pausen.
Örtliche Gegebenheiten,
wie unzureichende Beleuchtung oder schlechte Raumluft.
1.5 Neue Arbeitsformen
Die Digitalisierung und veränderte Arbeitsstrukturen bringen neue Herausforderungen mit sich:
Homeoffice
kann zwar Flexibilität bieten, führt aber auch zu sozialer Isolation und Verwischung von Arbeits- und Privatleben.
Digitale Dauerpräsenz
(„Always-on“-Mentalität), die ständige Erreichbarkeit und Reaktionsdruck erzeugt.
Hybride Strukturen,
die Kommunikations- und Abstimmungsprozesse komplexer machen.
Erhöhte Selbstorganisationsanforderungen
ohne ausreichende Unterstützung.
Fazit:
Psychische Belastungen sind im Arbeitsschutz kein Randaspekt, sondern ein struktureller Faktor, der in allen Ebenen der Arbeitsgestaltung berücksichtigt werden muss – von der konkreten Tätigkeit bis hin zur Unternehmenskultur. Die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen bietet hier ein zentrales Werkzeug, um Risiken zu erkennen und systematisch zu reduzieren.
2. Ursachen & Risikofaktoren
Psychische Belastungen entstehen nicht zufällig, sondern sind oft das Ergebnis struktureller, organisatorischer oder sozialer Faktoren im Arbeitsumfeld. Manche davon treten einzeln auf, oft aber verstärken sie sich gegenseitig. Die wichtigsten Ursachen und Risikofaktoren sind:
2.1 Überlastung durch Personalmangel oder unrealistische Deadlines
Wenn Arbeitsaufgaben nicht mehr in einem realistischen Zeitrahmen zu bewältigen sind, steigt der Druck kontinuierlich an.
Typische Auslöser:
-
Personalmangel durch Krankheit, Fluktuation oder fehlende Nachbesetzungen.
-
Enge Projektfristen, die keine Pufferzeiten erlauben.
-
Dauerhafte Mehrarbeit, die zu Erschöpfung und sinkender Leistungsfähigkeit führt.
Langfristig führt eine solche Überlastung zu chronischem Stress, erhöhtem Fehleraufkommen und im schlimmsten Fall zu Burnout.
2.2 Fehlende Wertschätzung und Anerkennung
Neben materiellen Aspekten wie Gehalt ist die soziale Anerkennung ein entscheidender Motivationsfaktor. Fehlt diese Wertschätzung, kann dies zu Demotivation und innerer Kündigung führen.
Beispiele:
- Leistungen werden als selbstverständlich hingenommen.
- Erfolge werden nicht kommuniziert oder gefeiert.
- Vorgesetzte geben nur negatives Feedback oder üben Kritik ohne konstruktive Hilfestellung.
2.3 Rollenunklarheit und widersprüchliche Erwartungen
Wenn unklar ist, welche Aufgaben, Verantwortlichkeiten oder Entscheidungsbefugnisse eine Person hat, entsteht Verunsicherung und Stress.
Risikobeispiele:
-
Unklare Stellenbeschreibungen, die Spielräume und Erwartungen nicht definieren.
-
Gegensätzliche Anweisungen von verschiedenen Vorgesetzten oder Abteilungen.
-
Fehlende Abstimmung zwischen Teams, was zu Doppelarbeit oder Verantwortlichkeitskonflikten führt.
2.4 Dauerhafte Unterbrechung des Biorhythmus
Der menschliche Körper folgt natürlichen Schlaf- und Wachzyklen. Wird dieser Rhythmus dauerhaft gestört, leidet nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische Gesundheit.
Typische Ursachen:
- Schichtarbeit mit häufigen Wechseln zwischen Tag- und Nachtschichten.
- Frühschichten mit dauerhaft verkürzter Schlafdauer.
- Internationale Zusammenarbeit mit regelmäßigen Terminen außerhalb der normalen Arbeitszeit.
Solche Störungen beeinträchtigen die Erholungsfähigkeit und erhöhen das Risiko für Depressionen und Angststörungen.
2.5 Technostress – ständige Erreichbarkeit durch digitale Medien
Die Digitalisierung bringt Effizienz, aber auch neue Stressfaktoren. Technostress beschreibt den Druck, ständig erreichbar und sofort reaktionsfähig sein zu müssen.
Belastungsfaktoren sind:
-
„Always-on“-Mentalität: E-Mails, Chats und Anrufe auch außerhalb der regulären Arbeitszeit.
-
Informationsüberflutung durch unstrukturierte digitale Kommunikation.
-
Ständige Software- und Toolwechsel, die Anpassungsdruck erzeugen.
-
Fehlende klare Regeln zur digitalen Erreichbarkeit.
Praxis-Hinweis:
Diese Ursachen treten oft kombiniert auf – etwa wenn hoher Personalmangel (Punkt 2.1) und fehlende Wertschätzung (Punkt 2.2) auf eine unklare Rollenverteilung (Punkt 2.3) treffen. Dann steigt das Risiko für psychische Erkrankungen sprunghaft an.
Mit WEMAktuell immer informiert!
Verpassen Sie zukünfitg keine unserer praxisbezogenen Fachartikel und Blogbeiträge mehr. Erhalten Sie Checklisten und Leitfäden, zu den Themen Informationssicherheit, Datenschutz & DSGVO, Digitalisierung & KI, Webtechnologien, Arbeitsschutz, Normen & Compliance – verständlich erklärt, aktuell und präzise.
3. Auswirkungen – Warum Unternehmen handeln müssen
Anstieg psychischer Erkrankungen & Fehlzeiten: dramatische Zahlen
In den letzten Jahren ist ein starker Anstieg der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen zu beobachten. Laut BAuA stiegen die Arbeitsunfähigkeitstage von 45,4 Millionen (2003) auf 123,3 Millionen (2021) an – nahezu eine Verdreifachung in weniger als zwei Jahrzehnten. Quelle
Die DAK-Gesundheit berichtet für 2022 von 301 Fehltagen je 100 Versicherte, das sind +48 % im Vergleich zu vor zehn Jahren. Quelle DAK
Psychische Erkrankungen gehören inzwischen zu den Hauptursachen für Fehlzeiten – mit erheblichen Konsequenzen für Unternehmen und Wirtschaft.
Anstieg psychischer Erkrankungen & Fehlzeiten: dramatische Zahlen
Fehlzeiten durch psychische Erkrankungen belasten die Wirtschaft massiv. Eine Analyse zeigt, dass die hohe Krankheitsquote 2023 dazu führte, dass die deutsche Wirtschaft nicht wachsen, sondern um –0,3 % schrumpfen konnte – was ein wirtschaftliches Minus von etwa 26 Milliarden Euro bedeutete
Doch nicht nur das: Arbeitsminister Hubertus Heil betonte, dass psychische Erkrankungen zu Produktionsausfällen im Milliardenbereich führen – und regelmäßige betriebliche Vorsorge bislang unzureichend umgesetzt ist.
Weitere wirtschaftliche Auswirkungen im Überblick
-
Höhere Fluktuation und Recruitingkosten: Erhöhte Krankheitsraten demotivieren Mitarbeitende und belasten Teams – was zu mehr Austritten und höheren Kosten für Neueinstellungen führt.
-
Verlust von Know-how: Langzeitkranke oder dauerhaft belastete Mitarbeitende können ihr fachliches Wissen nur begrenzt einbringen – Know-how geht verloren.
-
Negatives Betriebsklima: Wenn psychische Belastungen übergreifen (z. B. durch Mobbing), leiden Motivation, Teamzusammenhalt und Innovationsfähigkeit erheblich. Studien beziffern die Kosten eines mobbingbedingten Fehltags auf bis zu 410 € – berücksichtigt sind Fehlzeiten, Minderleistung, Konfliktkosten und Reputationsverlust.
- Erhöhtes Unfallrisiko: Konzentrations- und Denkblockaden bei psychisch Belasteten erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und Arbeitsunfällen – was zusätzliche Risiken und Kosten für Unternehmen schafft.
Externe Druckfaktoren: Corona, Ukraine-Konflikt, Lebenshaltungskosten
Die genannten Entwicklungen werden durch externe Belastungen weiter verschärft:
Corona-Pandemie:
Soziale Isolation, Existenzängste, Trauer und dauerhafte Unsicherheiten haben viele Beschäftigte psychisch stärker belastet – das zeigte sich u. a. in der damals massiv gestiegenen Belastungsquote innerhalb kürzester Zeit.
Kriege, Konflikte & Sanktionen:
Energiekrise, Lieferengpässe, Spannungen in Europa zwischen Russland und der Ukraine oder Israel und dem Iran sowie allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit wirken als Stressverstärker – sowohl bei Angestellten als auch bei Unternehmen, etwa durch Angst vor Arbeitsplatzverlust oder Existenzgefährdung.
Teurere Lebenshaltungskosten:
Inflation und Kaufkraftverlust erhöhen den psychischen Druck auf Mitarbeitende – finanzielle Ängste wirken sich unmittelbar auf die psychische und physische Leistungsfähigkeit aus.
Leistungsfähigkeit: Gesundheit als zentrale Produktionsressource
Psychische Gesundheit ist damit keine private, sondern eine zentrale betriebliche Ressource: Gesunde Mitarbeitende sind motivierter, weniger ausfallanfällig, konzentrierter und langfristig produktiv. Fehlzeiten, Fluktuation, Produktivitätsverluste und Unfälle entstehen nicht zufällig – sie sind direkte Konsequenzen aus psychischen Fehlbeanspruchungen.
Trendfazit:
-
Fehltage durch psychische Erkrankungen haben sich deutlich erhöht – um bis zu 48 % innerhalb eines Jahrzehnts.
-
Die wirtschaftliche Belastung liegt im zweistelligen Milliardenbereich jährlich.
-
Externe Krisen (Pandemie, Krieg, Inflation) verschärfen die psychische Situation der Beschäftigten zusätzlich.
4. Gesetzlicher Rahmen
Der gesetzliche Arbeitsschutz in Deutschland ist im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verankert.
Gemäß § 5 ArbSchG – Beurteilung der Arbeitsbedingungen sind Arbeitgeber verpflichtet, alle Gefährdungen für die Gesundheit der Beschäftigten zu ermitteln und zu beurteilen – dazu gehören ausdrücklich auch psychische Belastungen.
Diese Pflicht gilt für alle Betriebe – unabhängig von Größe oder Branche – und ist nicht optional. Psychische Gefährdungen stehen dabei rechtlich auf derselben Stufe wie physische Risiken, etwa Lärm, chemische Stoffe oder Unfallgefahren.
Warum das wichtig ist
Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern auch ein zentrales Instrument zur Prävention. Sie unterstützt Unternehmen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Belastungen zu reduzieren und langfristig die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu sichern.
Rechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung:
Bußgelder:
von bis zu 25.000 € pro Verstoß (§ 25 ArbSchG).
Haftungsrisiken:
für Geschäftsführung und verantwortliche Führungskräfte.
Reputationsschäden:
durch negative Presse oder behördliche Maßnahmen.
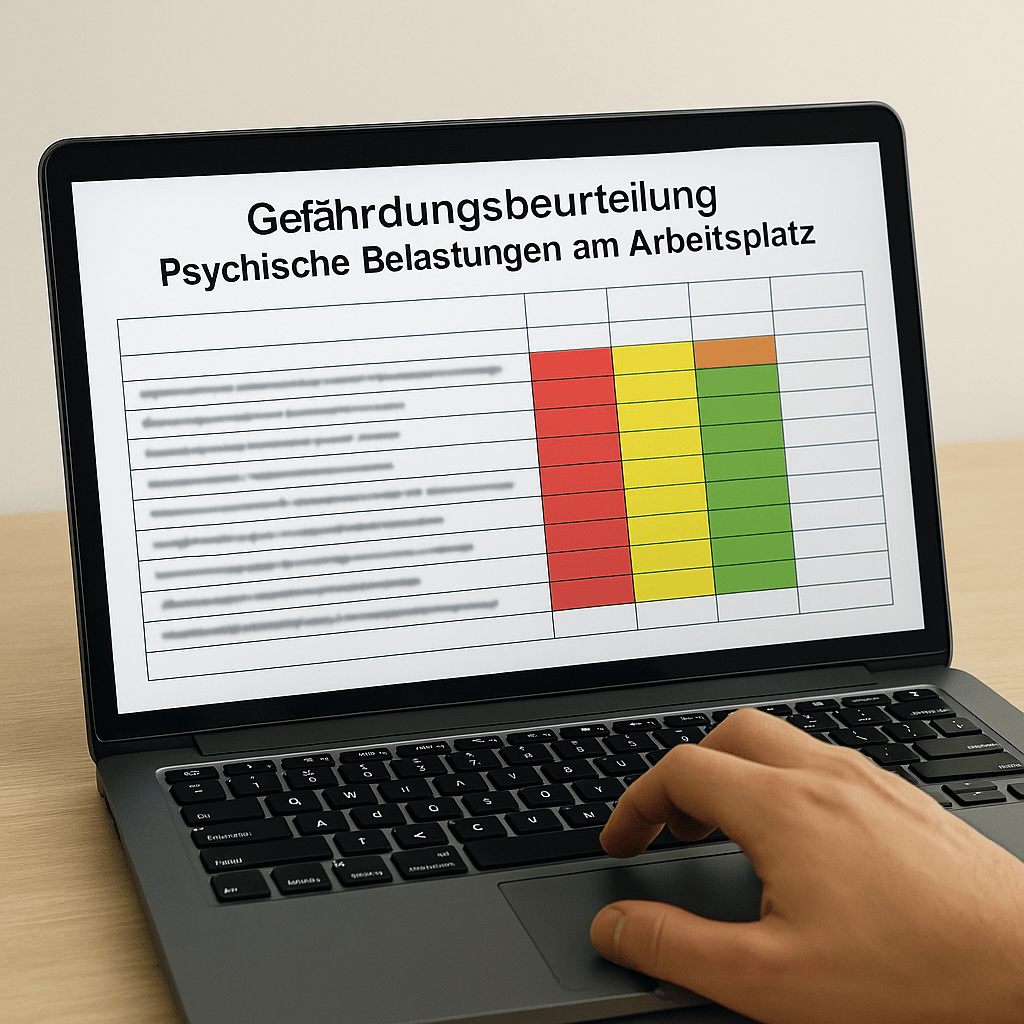
Weiterführende Informationen
Die konkrete Durchführung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen – inklusive Methoden, Ablauf und Praxisbeispielen – beschreibe ich ausführlich im separaten Beitrag: Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen – so setzen Sie die gesetzlichen Vorgaben um
5. Prävention & Ursachenbehandlung – der ganzeheitliche Ansatz
Psychische Belastungen lassen sich nicht vollständig vermeiden – aber ihre Häufigkeit, Intensität und Folgen können durch gezielte Maßnahmen deutlich reduziert werden. Ein wirksamer Ansatz muss ganzheitlich sein, d. h. er berücksichtigt sowohl strukturelle als auch menschliche Faktoren. Prävention bedeutet hier nicht nur, Probleme zu verhindern, sondern auch bestehende Belastungen frühzeitig zu entschärfen.
Ein nachhaltiges Konzept umfasst drei ineinandergreifende Ebenen:
5.1 Organisatorische Maßnahmen
Strukturen und Abläufe sollten psychische Stabilität fördern.
-
Klare Rollen: Aufgaben, Erwartungen und Verantwortlichkeiten eindeutig festlegen.
-
Realistische Ziele: Ambitioniert, aber erreichbar planen.
-
Pausen sichern: Erholung aktiv einplanen, nicht dem Zufall überlassen.
-
Flexible Arbeitszeiten: Modelle wie Gleitzeit oder Homeoffice zur Entlastung nutzen.
5.2 Soziale Maßnahmen
Ein wertschätzendes Miteinander ist ein Schutzfaktor.
-
Führungskräfte schulen: Empathisch kommunizieren, Belastungen erkennen.
-
Konflikte früh klären: Klare Prozesse, neutrale Ansprechpersonen.
-
Mentoring: Erfahrene Kolleg:innen begleiten Neue.
5.3 Individuelle Unterstützung
Gezielte Angebote helfen bei persönlichen Belastungen.
-
BGM-Angebote: Bewegung, Entspannung, Ernährung.
-
Psychologische Beratung: Vertraulich, intern oder extern.
-
Resilienztrainings: Selbstmanagement und Stressbewältigung stärken.
6. Umgang mit bereits belasteten Mitarbeitern
Kostenlos downloaden & sofort einsetzen – Ihre 5-Schritte-Checkliste – Umgang mit psychisch belasteten Mitarbeitenden“
7. Praxisbeispiel – Vom Risiko zur Ressource
Ergebnisse der Analyse:
Besonders deutlich traten zwei Hauptstressoren zutage:
Unklare Prioritäten
Mitarbeitende erhielten oft widersprüchliche Anweisungen aus unterschiedlichen Abteil
ungen, was zu Verunsicherung und ineffizienter Arbeitsweise führte.
Ständige Unterbrechungen
Häufige Ad-hoc-Anfragen, ungeplante Meetings und permanenter E-Mail-Verkehr unterbrachen konzentrierte Arbeitsphasen, was den Druck zusätzlich erhöhte.
Umgesetzte Maßnahmen:
Das Unternehmen reagierte gezielt auf die identifizierten Stressoren:
Einführung klarer Abstimmungsroutinen zwischen den Abteilungen, um Prioritäten eindeutig festzulegen und Konflikte in der Aufgabenverteilung zu vermeiden.
Festlegung von „Fokuszeiten“ – Zeitfenster, in denen Mitarbeitende ungestört arbeiten können, ohne durch Meetings oder Anrufe unterbrochen zu werden.
Schulung der Führungskräfte in Delegations- und Priorisierungstechniken, um Aufgaben besser zu strukturieren und Mitarbeitende zu entlasten.
Ergebnisse nach 6 Monaten:
Die Wirkung war deutlich messbar: Die Krankenquote sank um 15 %, und die Ergebnisse einer erneuten Mitarbeiterbefragung zeigten eine spürbare Steigerung der Zufriedenheit und Motivation. Auch das Betriebsklima verbesserte sich – in Feedbackgesprächen berichteten viele Mitarbeitende, dass sie sich weniger gestresst und deutlich besser organisiert fühlten.
Lernpunkt:
Gezielte Maßnahmen gegen psychische Belastungen wirken nicht nur präventiv, sondern steigern auch die Leistungsfähigkeit und Bindung der Mitarbeitenden – und das ohne große Investitionen, sondern vor allem durch organisatorische Klarheit und gelebte Führungskultur.
8. Einladung zum nächsten Schritt
Psychische Belastung am Arbeitsplatz ist kein Randthema, sondern eine zentrale Führungs- und Managementaufgabe. Sie beeinflusst nicht nur die Gesundheit und Motivation der Mitarbeitenden, sondern auch Produktivität, Qualität und langfristigen Unternehmenserfolg.
Viele Führungskräfte und Personalverantwortliche stehen dabei vor denselben Herausforderungen: Belastungssignale früh zu erkennen, angemessen zu reagieren und gleichzeitig gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Oft fehlt jedoch ein praxisnaher Leitfaden, wie Prävention und aktives Handeln im Alltag aussehen können.
Genau hier setzt unser praxisorientiertes Seminar an. Gemeinsam mit Therapeuten vermitteln wir Ihnen nicht nur das nötige Fachwissen, sondern geben Ihnen konkrete Werkzeuge an die Hand, um psychische Belastungen im Unternehmen wirksam zu begegnen. Sie profitieren von einer Kombination aus rechtlicher Expertise, psychologischem Know-how und direkt umsetzbaren Handlungstipps.
Inhalte des Seminars:
- Gesetzliche Anforderungen & Gefährdungsbeurteilung – Überblick über Pflichten, Chancen und Risiken.
- Psychologische Grundlagen & Stressmodelle – Verständnis für Ursachen und Wirkmechanismen psychischer Belastung.
- Praxisübungen zu Gesprächsführung in Belastungssituationen – sicher und wertschätzend kommunizieren.
- Präventionskonzepte für nachhaltigen Arbeitsschutz – Maßnahmen, die wirken und Bestand haben.
- Fallbeispiele & individuelle Lösungspläne – direkter Transfer in Ihre betriebliche Praxis.
Zielgruppe:
Führungskräfte, Personalverantwortliche, Betriebsräte und Arbeitsschutzbeauftragte, die Verantwortung übernehmen und ihr Unternehmen psychisch gesund und zukunftsfähig gestalten wollen.
Anmeldung:
Die Anmeldung zu unserem Seminar erfolgt unkompliziert telefonisch unter (+49) 0681 38 75 42 80 oder per E-Mail an info@wemacon.de. Die aktuellen Termine werden Ihnen nach der Anmeldung rechtzeitig mitgeteilt und sind zudem jederzeit in unserem Bereich unter Schulung und Coaching auf unserer Website abrufbar.
Kontaktieren Sie uns jetzt für ein unverbindliches Erstgespräch! Gemeinsam erhöhen wir die Sicherheit in Ihrem Betrieb – effektiv, rechtssicher und praxisorientiert.
Weitere Beiträge, die Sie interessieren könnten:

Pläne zur DSGVO-Reform 2025: Entlastung für KMU in Sicht?
DSGVO-Reform 2025 – echte Entlastung für KMU oder nur ein politisches Signal? Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit 2018 das...
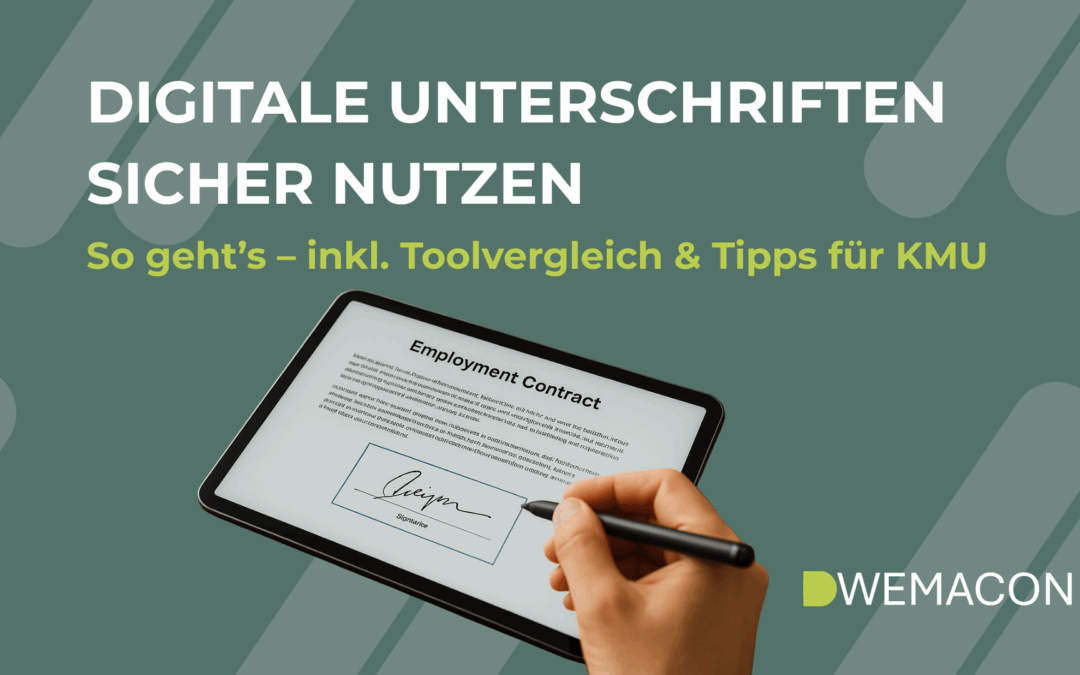
Digitaler Wandel bei Arbeitsverträgen: Digitale Unterschriften rechtssicher nutzen – so geht’s
Warum digitale Signaturen jetzt wichtiger sind denn je Hybrides Arbeiten, mobiles Onboarding, digitale Unterweisungen – Unternehmen stehen...

Lithium-Akkus: Die unterschätzte Gefahr im Betrieb
Warum dieses Thema aktueller ist denn je Lithium-Ionen-Akkus sind aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken: Sie stecken in...